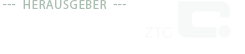Wirksamkeitsnachweis und positive ökonomische Effekte als zentrale Größen
Wenn es um die Aufnahme neuer Verfahren und Arzneimittel in die Vergütungskataloge des deutschen Gesundheitswesens geht, ist der Nachweis der Wirksamkeit und Sicherheit für Patientinnen und Patienten unerlässlich. Zunehmend werden aber auch gesundheitsökonomische Evaluationen zu einem entscheidungsunterstützenden Instrument, wenn über die Erstattungsfähigkeit neuer Produkte oder Verfahren entschieden wird. Angesichts begrenzter Ressourcen in den europäischen Gesundheitssystemen sollen ökonomische Studien eine wissenschaftlich fundierte Grundlage bei der Entscheidung für oder gegen eine Aufnahme in die Leistungskataloge der Krankenversicherungen geben. In Deutschland existiert bspw. seit dem Jahre 2000 das Health Technology Assessment (HTA) Programm des Bundesgesundheitsministeriums, welches durch das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) koordiniert wird (vgl. Greiner, Schöffski, v.d. Schulenburg (2008), S. 491).
Dieser Umstand ist auch für eine mögliche Vergütungsfähigkeit telemedizinischer Anwendungen bzw. Produkte wichtig. Auf internationaler Ebene wurden in den letzten Jahren zahlreiche Studien unterschiedlicher Art für diverse telemedizinische Anwendungen durchgeführt. So sind bei PubMed fast 6.000 Suchergebnisse unter dem Stichwort „Telemedicine“ alleine aus den letzten fünf Jahren verfügbar und regelmäßig kommen neue Studienergebnisse hinzu.¹ Bei Durchsicht der Ergebnisse fällt auf, dass durchaus viele Studien existieren, die positive Outcomes bei telemedizinischen Anwendungen zeigen können, bspw. hinsichtlich einer Verbesserung folgender Parameter:
• Intersektorale/interdisziplinäre Kommunikation
• Klinische Outcomes wie Mortalität und Morbidität
• Sicherstellung einer Versorgung in ländlichen/strukturschwachen Gebieten
• Kosteneffizienz/Wirtschaftlichkeit
• Qualität der Versorgung
• Verfügbarkeit von medizinischer/pflegerischer Expertise unabhängig von Raum (und Zeit)
Ebenso bestätigen die von der ZTG GmbH erstellten Evidenzreports/Studienrecherchen in den telemedizinischen Anwendungsfeldern „Diabetes mellitus“ (mit 13 Studien), „Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)“ (mit 16 Studien), „Wundmanagement“ (mit 11 Studien), „Psychotherapie“ (mit 19 Studien), „Augenhintergrundscreening“ (mit 9 Studien), „Intensivmedizin“ (mit 22 Studien), „Morbus Parkinson“ (mit 5 Studien) sowie „Kardiologie“ (mit 61 Studien) diese Beobachtungen.
Da erscheint es auf den ersten Blick verwunderlich, warum telemedizinische Leistungen nicht schon länger zum GKV-Leistungskatalog gehören und die Resultate der Studien bei den Entscheidungsträgerinnen und -trägern im deutschen Gesundheitswesen nur wenig Beachtung zu finden scheinen. Es stellt sich daher die Frage: Lassen sich die Ergebnisse internationaler und/oder multinationaler Studien einfach auf Deutschland und das nationale Gesundheitswesen übertragen?
Differenzierung zwischen Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
Zur Beantwortung dieser Frage gilt es zunächst einmal zu differenzieren bezüglich der Ergebnisse zur Wirksamkeit einerseits und zu den ökonomischen Aspekten anderseits. Bei Arzneimitteln bspw. liegen oftmals nur multinationale Studiendaten zur Verfügung. Die meist hohe Anzahl von eingeschriebenen Patientinnen und Patienten durch das globale Studiendesign ist zur Beurteilung der (klinischen) Wirksamkeit günstig, da eine höhere statistische Aussagekräftigkeit erreicht wird als wenn bspw. nur Daten aus einer regionalen Analyse vorliegen würden (vgl. Greiner, Schöffski, v.d. Schulenburg (2008), S. 492 sowie Sculpher, MJ, Drummond MF et al. (2004), Generalisability in economic evaluation studies in healthcare: a review and case studies, S. 93f). Dies bedeutet für telemedizinische Anwendungen, dass Studiendaten aus anderen Ländern im Hinblick auf klinische Outcomes bzw. die Wirksamkeit prinzipiell auf Deutschland übertragbar sind. Zeigen sich bspw. in einer amerikanischen Studie positive Effekte durch Telemonitoring bei Bluthochdruckpatientinnen und -patienten oder durch Telekonsile auf Intensivstationen, so ist davon auszugehen, dass deutsche Patientinnen und Patienten und/oder Ärztinnen und Ärzte ebenso vom Nutzen telemedizinischer Verfahren profitieren werden. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich physische und/oder psychische Merkmale bzw. Konstitutionen zwischen verschiedenen Ländern und Ethnien so deutlich unterscheiden, dass sich telemedizinische Verfahren gänzlich anders auswirken.
Ökonomische Evaluationen als besondere Herausforderung
Anders sieht es aus ökonomischer Sicht aus, wo sich deutlich mehr Herausforderungen in Hinblick auf eine Übertragbarkeit internationaler Studiendaten zeigen. Durch die jeweils unterschiedliche Ausgestaltung der nationalen Gesundheitssysteme und teils schon regional differierende Versorgungssettings kann es deutliche Abweichungen im Hinblick auf den Ressourceneinsatz und damit verbundene Mehrkosten oder Kosteneinsparungen geben (vgl. Wilke, RJ (2003), S. 1f (Tailor-made or off-the-rack? sowie Greiner, Schöffski, v.d. Schulenburg (2008), S. 492f). Auch profitieren verschiedene Stakeholder wie Krankenkassen, Krankenhäuser sowie Patientinnen und Patienten jeweils unterschiedlich stark von (telemedizinischen) Programmen. Daher variieren ökonomische Evaluationen im internationalen Vergleich (vgl. Sculpher, MJ, Drummond MF et al. (2004), Generalisability in economic evaluation studies in healthcare: a review and case studies, S.94).
Zunächst einmal können sich die Preise und Mengen von Land zu Land unterscheiden. Es gibt länderspezifische Preise für bestimmte Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen. Zudem ergeben sich Herausforderungen bei der Definition der zu bewertenden Mengengröße, bspw. Anzahl der ambulanten Arztkontakte, die sich insbesondere bezüglich der Ausgestaltung der Honorartarife teils erheblich voneinander unterscheiden können (vgl. Wilke, RJ (2003), S. 2 (Tailor-made or off-the-rack? sowie Greiner, Schöffski, v.d. Schulenburg (2008), S. 494f). Eine weitere zentrale Herausforderung betrifft die Vergleichbarkeit der Ressourcenverbräuche. Welte und Leidl (1999, S. 178ff) berichten von Unterschieden im Ressourcenverbrauch im Hinblick auf den technologischen, epidemiologischen, demographischen und systemimmanenten Kontext:
• Technologischer Kontext:
Hierzu gehören Skaleneffekte und die Kapazitätsausnutzung. Es ist möglich, dass bspw. eine Technologie in einem Land effizienter eingesetzt wird als in einem anderen Vergleichsland. Ferner gehören hierzu auch personelle Charakteristika. Der Ausbildungsgrad sowie die Fortbildungsmöglichkeiten des medizinischen und nichtmedizinischen Personals insbesondere auch im Hinblick auf neue Technologien und die jeweilige Arbeitsweise (z. B. der Umstand, wie viel Wert auf Hygiene und steriles Arbeiten gelegt wird) können zu einer Über- oder Unterschätzung von Kosten eines anderen Landes führen.
• Epidemiologischer Kontext:
Bezüglich epidemiologischer Aspekte kann es international große Abweichungen hinsichtlich der Inzidenz und Prävalenz von Krankheit und Komorbidität, der Altersstruktur, der Geschlechterverteilung, des Lebensstils, der Umwelteinflüsse sowie Bevölkerungswanderungen (Migration und Reisen) geben, die alle einen entsprechenden Einfluss haben können.
• Demographischer Kontext:
Aspekte wie die Lebenserwartung oder Reproduktionsrate spielen hier eine Rolle.
• Systemimmanenter Kontext:
Diesem Kontext sind Aspekte wie die Qualität der prä- und postinterventionellen Versorgung, der Verortung der Technologie in das jeweilige Gesundheitssystem (wird eine Leistung ambulant oder stationär erbracht?) sowie länderspezifische Anreizstrukturen (Vergütung von Einzelleistungen oder Pauschalen, Versicherungsdeckung für die Patientinnen und Patienten, Budgets für Krankenhäuser,…) zuzuordnen.
Anpassungsstrategien
Es lässt sich also festhalten, dass inter-/multinationale Studiendaten zu telemedizinischen Anwendungen im Hinblick auf Ergebnisse zur Wirksamkeit und auch Patientinnen- und Patientensicherheit auch auf das deutsche Gesundheitssystem übertragbar sind, es jedoch hinsichtlich ökonomischer Aspekte mitunter große Differenzen zwischen einzelnen Vergleichsländern geben kann. Dennoch wird die Bedeutung internationaler ökonomischer Evaluationen nicht nur in Deutschland zunehmen. Angesichts begrenzter Ressourcen auch im Hinblick auf die Durchführung (gesundheitsökonomischer) Studien können, insbesondere von kleineren Ländern, nicht immer eigene Studiendaten erhoben werden. Vielmehr sind bestimmte Anpassungsstrategien erforderlich.
Zu prüfen ist dabei zunächst einmal, inwieweit eine Anpassungsnotwendigkeit hinsichtlich der technologischen, epidemiologischen, demographischen sowie systemimmanenten Einflussfaktoren bei besteht. Nicht jeder potenzielle Einflussfaktor muss zwangsweise modifiziert werden, während andere eine sorgfältige Anpassung an das Zielland erfordern (vgl. Greiner, Schöffski, v.d. Schulenburg (2008), S. 498 sowie Wilke, RJ (2003), S. 3 (Tailor-made or off-the-rack?). Welte und Leidl (1999, S.199ff) empfehlen bspw. eine Prüfliste zur Entscheidung hinsichtlich der Übertragbarkeit ausländischer Studienergebnisse auf Deutschland. Dabei schlagen sie vor, die entscheidenden Übertragungsfaktoren wie Inzidenz und Prävalenz von Krankheiten, Verortung der Technologie in das Gesundheitssystem, Anreizstrukturen etc. hinsichtlich der Relevanz des Faktors (gegeben – nicht gegeben) für das jeweilige eigene Forschungsinteresse sowie die jeweilige Relevanzstärke und Übereinstimmung zwischen Studienland und Deutschland in einer Skala von sehr hoch bis sehr gering einzustufen. Diese Prüfliste dient als ein qualitatives Hilfsmittel für eine Einschätzung darüber, ob die Übertragbarkeit höher oder niedriger ist.²
Es bestehen verschiedene Ansätze zur Optimierung der Übertragung von Studienergebnissen in das deutsche Gesundheitssystem. Dazu gehören u.a.:
• Subanalyse aus der Gesamtstudie
Bei multinationalen Studien ist es mithilfe statistischer Verfahren wie der linearen Regression und multivariaten Analyse möglich, für einzelne Patientinnen- und Patientengruppen Subanalysen durchzuführen.
• Explorationsstudie zur Anpassung der Daten
Sofern Subanalysen nicht möglich sind, bspw. weil die Patientinnen- und Patientenzahlen der Studie zu klein waren, ist herauszufinden, wie das Mengen- und Preisgerüst im jeweiligen Zielland, also in diesem Fall in Deutschland, aussieht. Hierzu sind Anpassungen mit Hilfe von länderspezifischen Statistiken, Preisvergleichen (z. B. Vergleich des Honorarniveaus), Expertinnen- und Expertenbefragungen sowie Vergleichsstichproben aus dem Zielland notwendig, was mitunter sehr aufwändig sein kann.
• Entscheidungsanalytische Verfahren
Diese Verfahren haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Wichtiges Instrument sind hierbei sog. Entscheidungsbäume, die mit Wahrscheinlichkeiten und Kostendaten gezielt für potenzielle Behandlungssituationen und -ergebnisse arbeiten. Die Modelle sollen medizinisch und ökonomisch relevante Ereignisse und Verläufe wiederspiegeln. Sie beruhen meist auf Expertinnen- und Experteneinschätzungen (vgl. Greiner, Schöffski, v.d. Schulenburg (2008), S. 499ff sowie Welte und Leidl (1999), S.189ff).
Fazit
Die vorangegangen Ausführungen haben gezeigt, dass die Übertragbarkeit internationaler Studienergebnisse auf andere Länder wie bspw. Deutschland immer mehr an Bedeutung gewinnt und auch vor telemedizinischen Verfahren keinen Halt macht. Dem Wirksamkeitsnachweis und der ökonomischen Bewertung innovativer telemedizinischer Produkte und Verfahren kommt eine hohe Bedeutung zu, wenn es um die flächendeckende Verbreitung geht. Wichtig zu betonen ist, dass zwischen der Wirksamkeit und ökonomischen Aspekten in der Diskussion differenziert werden muss. Bezüglich nachgewiesener Wirksamkeit telemedizinischer Verfahren gilt es zu beachten, dass internationale Studien unterschiedlichen Studientyps auch in Deutschland Beachtung finden sollten, sofern sie von ausreichender methodischer Qualität sind und demnach nicht vorschnell mit dem Hinweis auf eine mangelnde Übertragbarkeit ignoriert werden sollten.
Größere Herausforderungen sind hingegen bezüglich der Übertragbarkeit ökonomischer Studienresultate zu bewältigen. Die jeweils unterschiedliche Ausgestaltung des nationalen Gesundheitssystems und umweltbezogene sowie ggf. auch kulturelle Einflüsse können zu teils erheblichen Unterschieden bei den Ergebnissen führen und verursachen, dass Kosten über- oder unterschätzt werden. Individuelle Anpassungsstrategien für jedes Land oder gesamthafter für Länder mit ähnlichen Gesundheitssystemen sind hierbei erforderlich. Dies betrifft insbesondere eine Anpassung des Mengen- und oder Preisgerüsts.
Eine jeweils komplett neue Erhebung ökonomischer Studiendaten führt zu hohen Kosten und führt gelegentlich dazu, dass Patientinnen und Patienten potenziell nutzenstiftende telemedizinische Verfahren für längere Zeit vorenthalten werden. Ausreichend valide und transparente Modelle zur Abbildung der ökonomischen Situation im jeweiligen Zielland sind unumgänglich und erfordern aufgrund der methodischen Komplexität wissenschaftliche und anwendungsorientierte Diskussionen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene.
¹ Abfrage am 15.10.2015, Berücksichtigung nur von Ergebnissen, zu denen ein Abstract verfügbar ist.
² Nachzulesen bei Welte, R. und Leidl, R. (1999) in Übertragung der Ergebnisse ökonomischer Evaluationsstudien aus dem Ausland auf Deutschland: Probleme und Lösungsansätze. In: Leidl, v.d. Schulenburg, Wasem (Hrsg.): Ansätze und Methoden der ökonomischen Evaluation – eine internationale Perspektive. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
Termine
- Keine Termine
Beiträge
-

-
Auszug aus der Grundlagenexpertise „Alter und Gesundheit/Pflege“
15. Januar 2016 By marshu-dgt -

-

Telemedizinkongress in Berlin
10. Februar 2016 By marshu-dgt -

Das Pilotprojekt Afghan German Telemedicine
11. August 2015 By marshu-dgt -
Auszug aus der Grundlagenexpertise „Alter und Gesundheit/Pflege“
15. Januar 2016 By marshu-dgt
-

Telemedizin in der Region Ostwestfalen-Lippe
11. August 2015 By marshu-dgt -
-

Das Pilotprojekt Afghan German Telemedicine
11. August 2015 By marshu-dgt